Nah und fern
12. November 2018

© Ralf Ziervogel/VG Bild-Kunst, Bonn 2018
12. November 2018
In kaum einem Text, der Ralf Ziervogels zwischen zirka 2003 und 2011 entstandene figurative Federzeichnungen beschreibt, fehlt das Wort Comic. Die Beschreibungsabsicht bezieht sich dabei offenbar weniger auf den Comic als Medium, sondern zielt auf das redensartig Comichafte ab, als vage Referenz einer umgangssprachlich-sprichwörtlich überzeichneten, bizarren, verspielten oder motivisch drastischen Ästhetik. Dafür spricht auch, dass der Begriff gern in der Nachbarschaft von »Splatter« auftaucht – insgesamt etwa so, wie die von realer Gewalt oder einem Realismus-nahen Darstellungsmodus weit entfernte Gewaltinszenierung in Quentin Tarantinos Film Kill Bill mitunter comichaft genannt wird. Geschuldet ist diese Zuschreibung den grotesk verrenkten, in radikal entfesselter Physis verkeilten, bis zum Zerreißen und darüber hinaus gespannten Leibern, den überweit aufgerissenen Mäulern und Augen, den brutal penetrierten natürlichen sowie oftmals gewaltsam neu gestanzten Körperöffnungen, den Blutspritzereien, den karikaturartig verzerrten Physiognomien und sonstigen anatomischen Exzessen, vor denen die entsprechenden grafischen Werke Ziervogels wimmeln.
Abgesehen von dem Verdacht, dass immer auch ein bisschen Erleichterung mitschwingt, wenn etwas als comichaft erkannt wird, da dies Distanz zu unangenehm derben Bildinhalten schafft: Ralf Ziervogels zeichnerisches Schaffen liefert noch weitere gute, wenn auch keinesfalls verbindlich zwingende Gründe dafür, es probehalber mit jenen Darstellungs- und Ausdrucksformen abzugleichen, die der gezeichneten Bildgeschichte bzw. sequenziellen Erzählkunst eigen sind. Die Krückstock-Anmutung einer solchen Gegenüberstellung ist vor allem deshalb augenfällig, weil es sich bei Ziervogel um einen energisch solitären Künstler handelt, dessen unberechenbares Werk keiner Schule oder Strömung angehört. Diesem Annäherungsversuch – Ziervogel neben den Comic gerückt – geht es um Anrisse, Einfälle und Auffallendes, entlang an ein paar Stichwörtern, in denen sich konkreter veranschaulicht, warum man angesichts von Ziervogels Zeichnungen ans Comichafte denken darf.
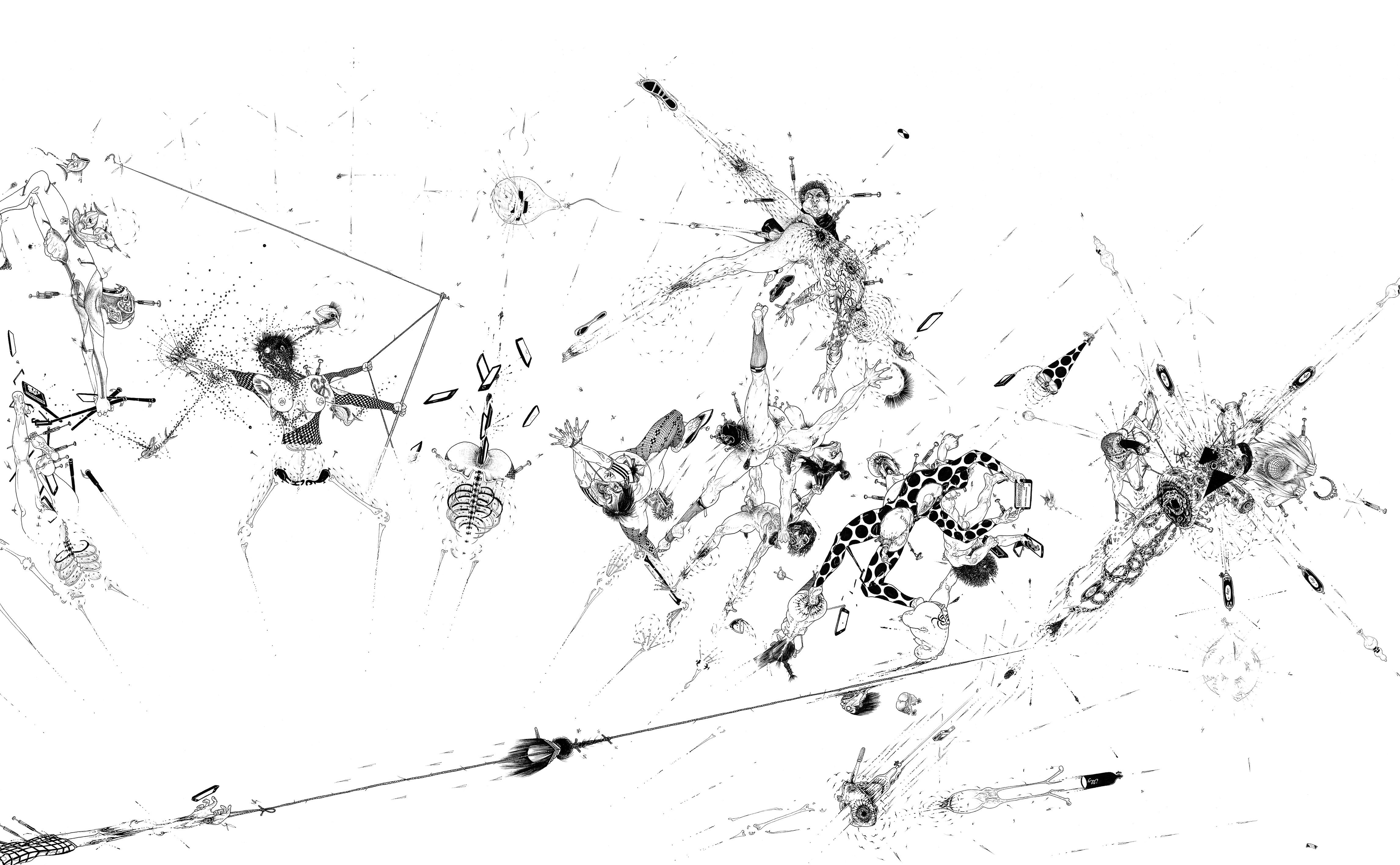
Zeichnung
In der bildenden Kunst steht das Zeichnen in latent
zwiespältigem Ruch, trotz kanonischer Zeichner wie Albrecht Dürer,
Gustave Doré oder Francisco de Goya. Einerseits ist es
Grundlagenhandwerk – der sichere und sichtbare Strich als Demonstration
ehrlicher Arbeit am Motiv, an Konturen, Proportionen, Perspektive,
Präzision, Räumlichkeit und Ähnlichkeit. Andererseits sieht die
Zeichnung neben dem Gemälde ein wenig blass aus – man assoziiert die
Skizze, die (Vor-)Studie, die Ideennotiz, die erste Annäherung, das
Unfertige – und klebt zudem sehr am Illustrativen; eben Handwerk, keine
Kunst. Die berühmten druckgrafischen Sammlungen Goyas wie die Caprichos,
die Desastres de la guerra oder die Disparates zum Beispiel wimmeln von
Mensch-Tier-Hybriden, Kannibalen, schreienden Irren, zerstückelten
Körpern, Folterern und Gefolterten.
Die naturgegebene Intensität der
Sujets, die dargestellten Kaprizen, Schrecken und Torheiten korrelieren
dabei mit den Kaprizen, Schrecken und Torheiten der Form: einem Mangel
an Form, der sich unübersehbar als grafisch Gemachtes, wie nervös
Hingeworfenes ausstellt, sich seriell auswächst und diese Werke mit
einem unruhigen Leben füllt, das der Hofmalerei ihres Schöpfers abgeht.
Motivisch stehen Ralf Ziervogels Tintenzeichnungen in durchaus enger
Verwandtschaft zu Goyas Grafiken, aber bei Ziervogel löst sich die
Zwiespältigkeit des Zeichnerischen in nichts auf. Die Lebendigkeit
seiner grafischen Werke entspringt weniger ihren maßlos exzessiven
Bildtopoi, sondern zuallererst ihrem Übermaß an Form. Ziervogels penibel
perfektionistischer Strich erhebt die Zeichnung wie selbstverständlich
zur Königsgattung. Die monströse Präzision der Linie geht derart weit,
dass der Vollzug zeichnerischer Techniken wie die der Linie oder der
Schraffur genauso hinter ihr verschwinden wie die Möglichkeit, das
unmittelbar Drastische des Gezeichneten komfortabel als sogenannte
Provokation zu entsorgen oder eine Ausdrucksabsicht des Künstlers zu
identifizieren.

Alles ist organisch und anorganisch zugleich, die Handschrift so unverkennbar wie in ihrer fast mechanistischen Akribie zutiefst unpersönlich. Wie Ziervogel es im Gespräch mit Daniel Völzke formuliert: »Mir geht es eher um Formales. Darum, der Architektur von Menschenkörpern näher zu kommen. […] Die filigrane Ausführung aber dämpft die Wucht ein wenig, weil die Arbeiten etwas von einer unantastbaren Kunstdevotionalie bekommen.«
Der Federstrich dient nur
vordergründig der gegenständlichen Darstellung – Hauptgegenstand der
Zeichnung ist der Strich selbst. Diese Konsequenz bleibt der
Comiczeichnung für gewöhnlich verwehrt. Im Comic ist die Zeichnung immer
auch Mittel zum Zweck. Sie steht im Dienst des Narrativen, fixiert
räumlich und zeitlich einen Handlungsausschnitt, wird in eine sich
optional gegenseitig unterstützende Balance mit dem Text gezwungen –
wobei der Comic die schriftsprachlichen Elemente, mit denen die Bilder
kombiniert werden, als Teil der Grafik präsentiert und wiederum
Ziervogels Zeichnungen nicht selten von Wörtern und Satzfetzen als
ornamentale, den weißen Bildgrund dynamisch strukturierende Ketten
durchzogen sind. Ziervogel ist sich als zeichnender Künstler mit dem
Comic darin einig, »den Blick in die Schwebe einer ›unmöglichen‹ Doppelorientierung zu bringen; er soll zugleich schauen und lesen, sehen
und entziffern«, wie Jens Balzer und Martin tom Dieck in ihrem Essay
Nicht versöhnt: Bilder und Texte im Comic (erschienen 1998 im
Schreibheft Nr. 51) feststellen.
Entgegen der strengen Präzision Ziervogels, die das Figürliche ganz dem Strich entwachsen lässt, ist die Comiczeichnung – bei aller Stil-, Formen- und Technikvielfalt – überwiegend der Kontur verpflichtet und lässt den Strich hinter dem Gegenstand idealerweise unsichtbar werden. Wenn man französischen Könner*innen wie Marcel Gotlieb alias Gotlib, Philippe Druillet, Claire Bretécher und Jean Giraud alias Moebius dank der ab 1969 im französischen Vorabendfernsehen ausgestrahlten Sendung Tac au Tac dabei zuschaut, mit welcher spontanen und traumwandlerischen Sicherheit sie Horizontlinien setzen oder überaus überzeugende Kamele skizzieren, mag man Ziervogels schwer erarbeitete Filigran-Fantasien und die leicht geführten Fasermaler der Comic-Routiniers vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen: den der Zeichnung als höchste Kunst des Handwerks.
Federn
Der kanadische Comic-Künstler Dave Sim, geboren 1956,
steht in der Stiltradition des klassisch-fotorealistischen
Schwarz-Weiß-Zeichnens. Seine Serie glamourpuss, zwischen 2008 und 2012
erschienen, ist ein als Modemagazin-Parodie getarnter historischer
Essay, der sich genau dieser Tradition widmet. Im vierten Heft
beschreibt Sim, wie Bernie Wrightson (1948-2017) in den 1970er Jahren
mittels Tusche-Schraffur seine legendären Horror-Comics,
Frankenstein-Illustrationen und
unverkennbaren Monster-Anatomien schuf, als Höchstmaß schierer
Unmöglichkeit: »Kein anderer Comiczeichner arbeitete mit so dünnen
Pinselstrichen wie Wrightson. Er tauchte das Haar in die Tinte und
rollte und rollte und rollte den Pinsel solange über ein Schmierblatt,
bis er ›scharf‹ genug war. Dann trug er eine, zwei oder drei sogenannte
Federn auf (schräge, sich verjüngende Tuschestriche). Danach war es an
der Zeit, den Pinsel auszuwaschen, zu trocknen, ihn wieder ins
Tintenfässchen zu tauchen, um zu rollen und zu rollen und zu rollen,
bis … Sie wollen wissen, wie Bernie Wrightson die kompletten 1970er
verbrachte? Schauen Sie sich die zehn Hefte Swamp Thing, eine Handvoll
Stories für die Horror-Magazine Creepy und Eerie sowie seine
Frankenstein-Grafiken an. Zieht man hier und da ein, zwei Stunden ab,
liegt es vor Ihnen: Bernie Wrightsons gesamtes Leben in den '70ern (ich
übertreibe nur ein ganz kleines bisschen).«
Das ist nicht wahnsinnig weit entfernt von Ziervogels Arbeit an der Architektur von Menschenkörpern und an mit diesen Körpern kollidierenden Objekten, wie etwa in Endeneu I von 2006. Wrightson musste sein Ding aus dem Sumpf nach zehn Ausgaben an einen anderen Zeichner übergeben, weil der Arbeitsaufwand ein massives Hindernis beim Einhalten kulturindustriell getakteter Abgabetermine darstellte. Eine solche Hingabe macht im populären Genre-Comic selten Schule. Wrightson ist Großgrafikern wie Doré oder William Hogarth näher als seinen Zunftkolleginnen und -kollegen. Das aus ähnlichen Gründen wie im Falle Wrightsons überschaubare, allerdings gänzlich ohne Schraffuren auskommende Werk von Geof Darrow (Hard Boiled, Shaolin Cowboy) besteht aus detailversessenen, bis zum Bersten mit Informationen vollgestopften Wimmelbild-Panoramen, in deren eingefrorenem Ereignis-, Gewalt- und Geschwindigkeitsreichtum das überforderte Auge vergeblich nach Überblick sucht – als triebe ein manischer Moebius im Art-brut-Rausch den durch das Werk Hergés (Tim und Struppi) geprägten Stilbegriff der Ligne claire = klaren Linie auf die hyperrealistische Spitze. Alex Toth (1928-2006, am Zeichenbrett verstorben), einer der auffälligsten amerikanischen Comic-Künstler der 1950er bis 1970er Jahre, setzt demgegenüber seine Federn so expressiv, breit und sparsam, dass angesichts der beinahe abstrakten Eleganz des Visuellen die generische Banalität des Stoffes (Zorro, Western Gunfighters, Young Romance) keine große Rolle spielt.
Original und Reproduktion
Mit unantastbaren Kunstdevotionalien
hat es der Comic nicht so. Im populären US-Comic herrscht traditionell
quer durch sämtliche Genres Arbeitsteilung. Das Szenario beziehungsweise Story und
Text, Vorzeichnung, Reinzeichnung mit Tusche, Kolorierung sowie oft auch
die Cover-Illustration werden von verschiedenen Leuten verantwortet.
Die in altehrwürdiger Weise produktiven Franzosen und Belgier teilen
sich die Arbeit zu zweit; allenfalls ist jemand drittes für die Farben
zuständig. Auch Autorencomicschöpfer*innen wie Chris Ware, Lewis Trondheim,
Donna Barr, Daniel Clowes, Frank Miller, Emil Ferris oder Manu Larcenet –
deren Comics bis hin zum Lettering in Personalunion entstehen –
betrachten nicht ihre Originalseiten, sondern das gedruckte
Buch/Heft/Album als finales, wahres Werk. Manchmal sind die
Originalzeichnungen kleiner, manchmal größer als in der reproduzierten
Version, manchmal ist das Format identisch. Bill Watterson, Schöpfer von
Calvin and Hobbes, dem schönsten aller amerikanischen Comicstrips, ist
bekannt dafür, das Sammlertreiben um (seine) Originale zu hassen, was
nichts daran ändert, dass sein lebhaft-dynamischer Strich in jeder noch
so ordentlichen Druckfassung zumindest ein klein bisschen absäuft. Der
französische Superstar Enki Bilal hingegen gestaltet – als eine der
raren Ausnahmen – seine Einzelpanels hinsichtlich Größe und malerischer
Anmutung inzwischen von vornherein so, dass sie als lukratives
Auktionsmaterial taugen.
Seit 2008 nimmt Ralf Ziervogel mit der Serie Every
Adidas Got Its Story die motivische und stilistische Ausrichtung seiner
früheren Zeichnungen auf, dieses Mal im reproduktions- und
comiclesefreundlicheren Klein- bzw. Großpostkarten-Format. Seine älteren
Werke stellen in ihrem ungeheuerlichen Gigantismus jedes
durchschnittlich bemessene Ausstellungshaus vor kuratorische Probleme.
(Nebenbei: Um die Schund-Aura des seit den frühen Siebzigern auch Neunte
Kunst genannten Comics dunkler zu dimmen und seine prinzipielle
hochkulturelle Anschlussfähigkeit hervorzuheben, verweisen Apologeten
gerne auf den 68 Meter langen Teppich von Bayeux.) Die Reproduktion
dieser Riesenobjekte erfolgt dementsprechend nicht als die Ausstellung
as if begleitender Katalog, sondern als von Ziervogel eigenhändig
gestaltetes Künstlerbuch. Es ermöglicht, die Zeichnungen auf neue Art
wahrzunehmen. Die im Ausstellungszusammenhang fordernde bis strapaziöse
Bildbetrachtung beginnt dem Lesen einer sequenziellen Bilderfolge zu
ähneln.
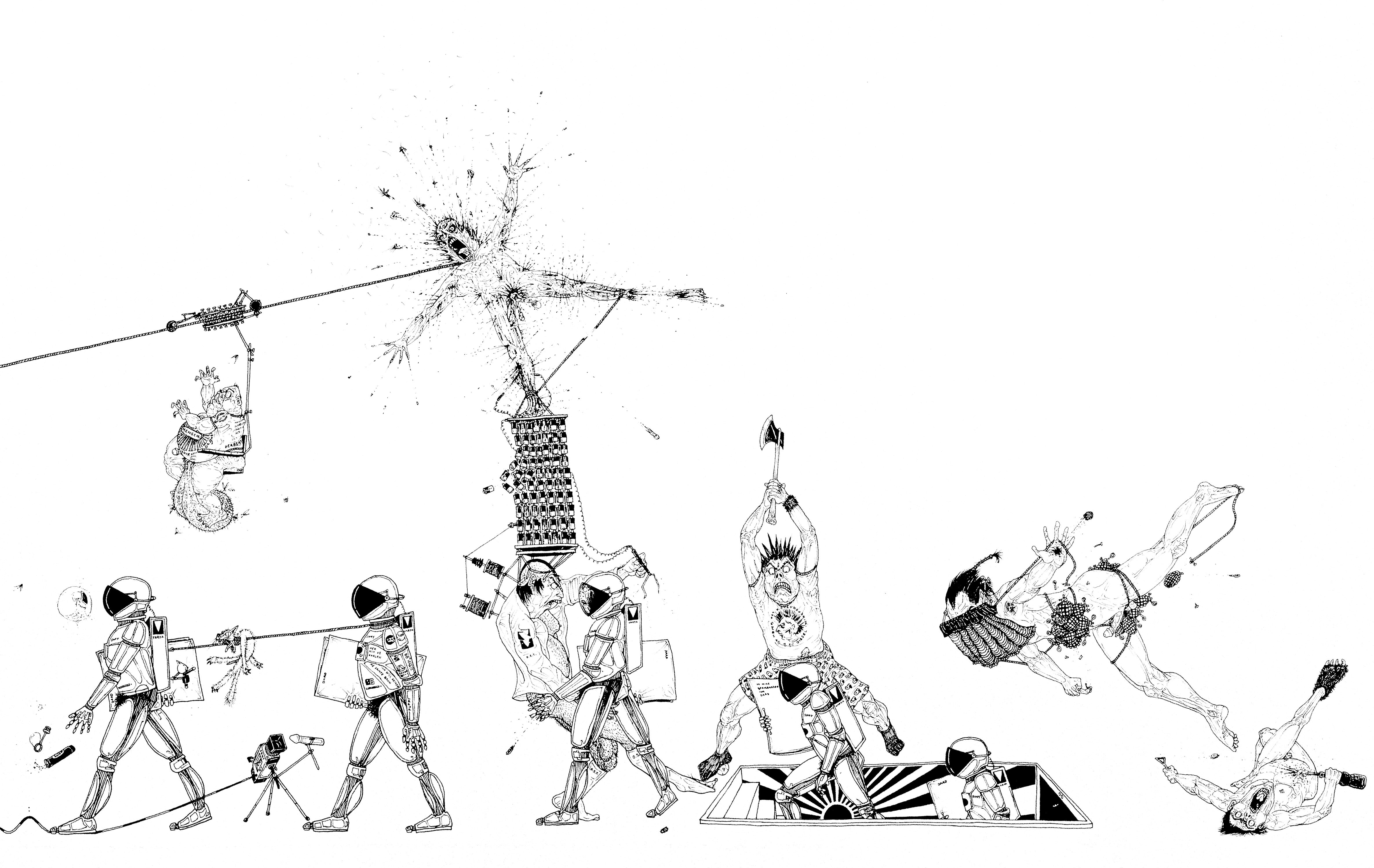
Panel, Raum und Körper
Die Lektüre eines Comics erfolgt längst
nicht so stur linear von ganz links oben bis ganz rechts unten wie bei
reinem Text, sondern funktioniert komplizierter. Mit den Worten des
Filmemachers Alain Resnais: »Wenn ich müde bin, lese ich einen Roman, wenn
ich hellwach bin, einen Comic. Das ist anspruchsvoller, weil man
zugleich eine visuelle und textuelle Botschaft entziffern muss.« Der
Blick gleitet flüchtig über die gesamte Doppelseite, bleibt an einem
Panel-Detail hängen, mustert kurz die restlichen Zeichnungen und
fixiert das erste Panel links oben. Man liest den Kästchen-, dann den
Sprechblasentext (oder andersrum), setzt die visuelle Botschaft in Bezug
zur textuellen, zunächst im engen Rahmen der Einzelpanelgrenze, danach
im Übergang zum nächsten Bild der vorgegebenen Sequenz, um schließlich
zu diesem und jenem Bild- oder Textbaustein zurückzuspringen und ganz am
Ende die Seite als Totale zu erfassen.
Ralf Ziervogels Zeichnungen
stellen, so gesehen, noch höhere Ansprüche: als aus den Nähten
geplatzte, gesprengte und in einer Ordnung gänzlich eigenen Rechts neu
formatierte Comicseiten. Die unzähligen Zollstöcke, Stäbe, Lampenhälse,
Strickleitern und Speere wirken nicht zuletzt vor der großflächigen weißen
Leere der Hintergründe, als hätte eine Implosion vormalige, mehr oder
weniger starre Panelraster dazu gezwungen, sich plötzlich als
eigenmächtige Elemente der anarchischen Dynamik der Figuren
anzuschließen. Wenn Ziervogel am unteren Rand von Ofu II (2006) räumlich
korrekte Bodenlöcher zeigt, denen Roboter oder Cyborgs entsteigen und
welche dem ständig nach perspektivischer Sicherheit suchenden Blick ein
wenig Orientierung verschaffen, ist dieser überraschend naive
Comic-Effekt ein wahrhaft abgründiger Bilder-Witz.
Die für viele japanische Mangas charakteristischen, auf etliche Seiten zerdehnten Actionsequenzen werden von Ziervogel gleichzeitig aufs Dichteste komprimiert und in neuen Endlos-Arrangements verschlungen, die dem Sequenziellen dessen Darstellungsfunktion als Struktur zeitlich aufeinander folgender Handlungsabläufe austreiben. Triebhaft-pervers verdrehte und im schlimmsten Fall buchstäblich auf links gezogene menschliche Gestalten, wie sie die Underground-Comix von Robert Crumb oder Greg Irons bevölkern, sind für Ziervogels Feder Body-Horror-Material, jeglichen narrativen oder anthropologischen Gerüsts beraubt, im Geiste der eiskalt autonomieästhetischen Parole des von H. G. Wells erschaffenen Vivisektionskünstlers Dr. Moreau: »Ich wollte – das war das Einzige, was ich wollte – die äußerste Grenze der Gestaltungsmöglichkeit in einer lebenden Form finden.« Bei aller provisorischen Nähe zu gewissen formalen Eigenheiten ist es dann doch die entschiedene, immerhin konstruktiv-symbiotische Ferne, in die sich Ralf Ziervogels Tintengrafiken zum Medium Comic setzen. Die Grenzen der sequenziellen Kunst sind wesentlich enger gezogen als die äußerste Grenze der Gestaltungsmöglichkeit.
Dr. phil. Sven-Eric Wehmeyer, geboren 1972, arbeitet als freier Redakteur, Übersetzer und Autor. Er hat ein starkes Faible für Horror, Comics und Heavy Metal.
Die Ausstellung RALF ZIERVOGEL – AS IF ist noch bis zum 27. Januar 2019 in der Sammlung Falckenberg zu sehen.